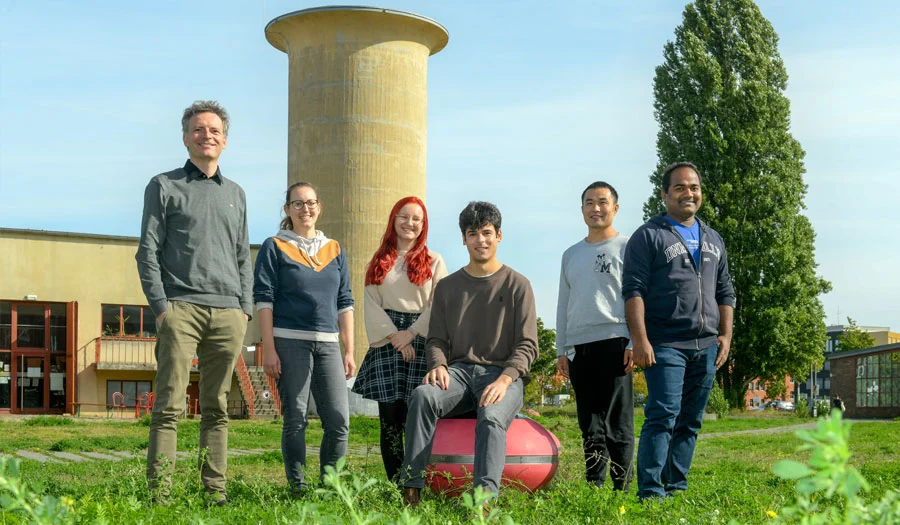Blackbox-Batterie
Adelhelm Group treibt alternative Batteriekonzepte voran
Wenn es um Stromspeicher für Elektrofahrzeuge und für den stationären Einsatz geht, führt bisher kein Weg an Lithium-Ionen-Akkus vorbei. Doch weltweit treiben Forscherteams alternative Batteriekonzepte voran. So auch die Arbeitsgruppe von Philipp Adelhelm, die am Institut für Chemie der Humboldt-Universität (HU) und am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) neue Materialansätze verfolgt.
Fünfundzwanzig junge Forscherinnen und Forscher aus zehn Nationen. Jede und jeder mit eigener Geschichte, eigenem kulturellen Hintergrund. „Sie können sich vorstellen, dass es bei unserer Laborarbeit lebendig zugeht“, sagt Philipp Adelhelm, der diese bunte Truppe aus Promovierten, Promovierenden und Studierenden leitet. Nicht nur Kulturen kommen in seiner Adelhelm Group zusammen, sondern auch Disziplinen: Chemie, Physik, Materialwissenschaften, Elektrochemie und Analytik. Ein komplexes wissenschaftliches und soziales Gefüge, das am Institut für Chemie der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und dem Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) tagtäglich daran arbeitet, mehr Licht in die Blackbox-Batterie zu bringen.
Rückblende: Als vor etwa 15 Jahren der Aufbruch in die Elektromobilität begann, ruhten große Hoffnungen auf Lithium-Ionen-Akkus. Zugleich barg die junge Batterietechnologie jede Menge Unsicherheiten: Fertigungstechnik und -verfahren für großformatige Batterien standen ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Die Kosten der Energiespeicher schienen nicht im Ansatz zu den Preisvorstellungen der Automobilbauer zu passen. Auch stand die ausreichende und ökologisch nachhaltige Versorgung mit Lithium oder den Metallen Kobalt und Nickel in den Sternen. Und nicht zuletzt bestanden Zweifel an der kalendarischen Lebensdauer, der Anzahl der Ladezyklen und an der Batteriesicherheit – zumal die Blackbox-Batterie nicht preisgab, welche chemischen und physikalischen Prozesse abseits des gewünschten Ionentransfers zwischen Anode und Kathode beim Laden, Entladen, aber auch im Ruhezustand ablaufen.
Hier findet sich ein erster Ansatzpunkt der Berliner Forschungsgruppe. Sie beobachtet die Prozesse in Lithium-Ionen-Akkus in situ, also während des Batteriebetriebs; daher firmiert sie auch unter dem Namen „operando battery analysis“. Während diese Forschung der weiteren Optimierung der Lithium-Ionen-Technologie im Sinne längerer Lebensdauer und höherer Energiedichte bei zugleich geringerem Materialeinsatz dient, liegen weitere Schwerpunkte von Adelhelms Team auf Natrium-Ionen-Batterien und auf neuartigen Konzepten, in denen gepresste Feststoffe die leicht entflammbaren flüssigen Elektrolyte heutiger Batterien ersetzen. Intrinsische Sicherheit, die sich allerdings noch im Stadium der Grundlagenforschung befindet.
Anders sieht es dagegen mit der Natrium-Ionen-Technologie aus. Unlängst kündigte einer der Platzhirsche der Batteriebranche – die chinesische Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) – den Serienstart von Natrium-Ionen-Akkus im Jahr 2023 an. „Das hat uns überrascht und zugleich sehr gefreut, weil es neuen Schwung in dieses Forschungsfeld bringt“, erklärt Adelhelm. Zwar erreichen die Natrium-Ionen-Akkus noch nicht die Energiedichte moderner Lithium-Ionen-Speicher. Doch sie übertreffen in dieser Hinsicht die lange favorisierte Nickel-Metall-Hydrid-Technologie, mit der Toyota einst den Hybrid-Antrieb populär machte. „Auch lassen sich bestimmte Natrium-Ionen-Akkus sehr schnell laden und sie sind weniger temperatursensibel als die Lithium-Ionen-Technik“, berichtet er. Die Liste der Vorteile sei damit nicht erschöpft. So lassen sich Natrium-Ionen-Akkus mit derselben Fertigungstechnik wie Lithium-Ionen-Akkus fertigen, wobei das teurere Elektrodenmaterial Kupfer durch Aluminium ersetzt werden kann. Und nicht zuletzt ist die Versorgung mit Natrium unproblematisch und der Einsatz der teuren, ökologisch und sozial bedenklichen Metalle Kobalt und Nickel wäre obsolet.
Ob sich die Technologie trotz der geringeren Energiedichte – die wahlweise auf mehr Gewicht oder geringere Reichweite hinausläuft – in der Elektromobilität oder eher im stationären Bereich durchsetzt, ist offen. Doch für die Adelhelm Group bringt die überraschende CATL-Ankündigung frische Motivation ins ohnehin sehr rege Laborleben. „Damit sich die Spannung von Zeit zu Zeit löst und der Spaß nicht zu kurz kommt, unternehmen wir oft Ausflüge in Berlin und Umgebung“, berichtet Adelhelm. Weil sich alle vom tagtäglichen Miteinander so gut kennen, fühle er sich dabei zuweilen wie auf einem Familienausflug.
Peter Trechow für Adlershof Journal